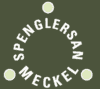Spenglersan Kolloide: Wichtiger Bestandteil der Erfahrungsmedizin mit medizinhistorischer Bedeutung
Dr. med. Carl Spengler, Entwickler der gleichnamigen Spenglersan Kolloide, wurde im Juni 1860 in der Tuberkulose-Klinik Davos geboren. Der berühmte Schweizer Kurort, gegründet vom Vater Dr. med. Alexander Spengler, war nicht irgendein Ort, an dem man zur Welt kommen konnte — er war das Mekka der Schwindsüchtigen. Auf der Suche nach Heilung strömten Menschen aus aller Herren Länder an diesen Siechenort bourgeoisen Lebensstils. Denn die Schwindsucht, die weiße Pest, hatte Europa fest im Griff.
Der Kurort Davos, die Tuberkulose und das Leben der Familie Spengler sind so eng miteinander verquickt, dass sich die säurefesten Stäbchen-Bakterien wie ein roter Faden durch das Leben Carl Spenglers ziehen. Er atmete den Erreger mit seinem ersten Atemzug ein und brach mit einem tödlichen Herzinfarkt über seinen Forschungsarbeiten zu selbigem Thema zusammen. Doch zunächst einmal studierte er Medizin in Tübingen, Heidelberg, Basel und Zürich.
Meilensteine Dr. med. Carl Spenglers und der Spenglersan Kolloide
1887 | Dissertation über die „Erblichkeit Multipler Exostosen“ an der Universität Straßburg. |
1890 | Vortrag zum Thema: „Behandlung starrwandiger Höhlen der Lungenphthise“ vor der „Gesellschaft fur Naturforscher und Arzte“ in Bremen. |
1892-1894 | Robert Koch wird auf ihn aufmerksam und holt ihn als Mitarbeiter nach Berlin. |
1903 | Zurück in Davos, setzt er seine wissenschaftlichen Arbeiten fort: „Beschreibung der Mischinfektion und Entwicklung der Immunkörperchen Therapien. |
1904 | Beitrag in der Festschrift zum 60. Geburtstag von Robert Koch (11. Dezember 1903). |
1905 | Ernst F, Sauerbruch (bedeutender und einfluss- reicher Chirurg des 20. Jahrhunderts) stellt sein Druckdifferenzverfahren (Thoraxchirurgie) vor. Die Grundlagen dieser Technik entwickelte Spengler bereits 1887 an der Universität Straßburg. |
1925 | Robert Koch erwähnt Spengler namentlich in seiner Nobelpreisrede. |
1936 | Auf Anregung seines Vorgängers an der Charité, August Bier, beginnt Sauerbruch die Homöo- pathie in die Tuberkulosebehandlung einzubeziehen. Er setzt u.a. das Immunkörperpräparat Tb. 1.-K. von Spengler, das heutige Spenglersan@ Kolloid T, ein. |
1925 | Paul A, Meckel, Mitarbeiter von Spengler und Begründer der Spenglersan GmbH, demonstriert in der Charité die Agglutination des Blutes durch Hinzugabe eines Spenglersan@ Kolloides dies war die Geburtsstunde des Spenglersan Bluttests. |
1937 | Dr. med. Carl Spengler verstirbt. |
1948 | Die Firma Meckel-Spenglersan wird nach Bonn Bad Godesberg verlegt. |
1949 | Die 1. Godesberger Ärztetagung, die Spenglersan Tagung, findet statt. |
1989 | Die Firma Spenglersan GmbH bezieht ihren heutigen Firmensitz in Bühl bei Baden-Baden. |
1992 | Neue klinische und experimentelle Forschungs- arbeiten über die von Spengler entwickelten Spenglersane durch Prof. Gerhard Bundschuh und Prof. Rainer C. Klopp, Gründer der Labore für klinische und experimentelle Immunologie und der Abteilung Mikrozirkulation an der Charité. |
1993 | Erste Spenglersan-Tagung, im Rahmen der Medizinischen Woche Baden-Baden. |
Spenglers Forschungsergebnisse – die Mischinfektion
Größter Verdienst Spenglers ist zweifelsfrei die Entdeckung der Mischinfektion, die er deutlich von einer Koinfektion unterschied. Er beschrieb eine Untrennbarkeit von Bakterien, die miteinander agieren und als heterologe Symbionten tief in das Granulationsgewebe eindringen, um dort ein Mischgift zu produzieren.
Aus heutiger Sicht beschrieb er die Biofilmbildung, einen Überlebensmechanismus schleimkapselbildender Bakterien, die sich vor einem Angriff des Immunsystems schützen. In der Forschung blieb dieser Aspekt lange unbeachtet, denn nach Koch arbeitete man nur noch mit isolierten Bakterien aus Nährmedien und nicht mehr mit befallenem Gewebe oder Sputum. Auch, dass das Mycobakterium tuberculosis tatsächlich, wie von Spengler beschrieben, ein Toxinbildner ist, übersah die Wissenschaft bis zu einer Veröffentlichung 2015. Carl Spengler war seiner Zeit also um einiges voraus.
Die Spenglersan Kolloide – gestern und heute
Aus seinen Erkenntnissen heraus entwickelte er die Immunkörperchen-Therapie: Antigen- und Antitoxin-Mischungen verschiedener abgetöteter Bakterien. Dabei bestand seine geniale Tat darin, solche Bakterien für die Herstellung seiner Präparate ausgewählt und gemischt zu haben, die in der Lage sind, Stoffe abzugeben, die die immunologische Abwehr modulieren. Ferner setzte er Verdünnungen ein und kam auf den Gedanken die Präparate über die Haut einzureiben.
Er modifizierte damit die damals üblichen Injektionstherapien, die in Ermangelung von Einmalmaterial mit hohen Risiken und Belastungen einhergingen.
Nach nun 100 Jahren Erfahrung mit den Spenglersan Kolloiden zeigt sich zum einen, dass sich der Therapieansatz und die Effekte in der Erfahrungsheilkunde oft bewährten. Und zum anderen, dass sich die Beobachtungen Spenglers durch viele neue Erkenntnisse decken.

Das Immunsystem der Haut – Ort ständigen Immuntrainings
Spengler entwickelte die perkutane Applikation, dabei hatte er keine Vorstellung vom Immunsystem der Haut. Er ging lediglich davon aus, dass diese als Körperbarriere eine spezielle immunologische Funktion besitzen muss. Damit lag er richtig, denn in ihr finden sich reichlich Spezialisten des Immunsystems, etwa 800 Langerhanszellen/mm2. Sie gehören zu den dendritischen Zellen und transferieren Informationen aus der Haut- und Schleimhautoberfläche an das tiefer liegende Immunsystem. Mit ihren sternförmigen Ausläufern ragen sie bis in die tight junctions von Haut und Schleimhautzellen hinein. Mit pumpförmigen Bewegungen suchen sie die Oberfläche nach fremden Antigenen und körpereigenem Material sowie Kommensalen ab. Langerhanszellen sind zur aktiven Vorwärtsbewegung befähigt, sie kommunizieren mit ihrer Umgebung über Zytokine und können die Oberfläche aktiv verlassen. Vorher geben sie einen Teil ihrer für die Antigen-Präsentation wichtigen MHC-Klasse-II-Moleküle an Mastzellen ab. Sie lassen die Oberfläche nicht unbewacht zurück.
Sie wandern zu den Lymphkanälen und werden passiv bis zum nächsten Lymphknoten transportiert. Dort, im Meeting Point des Immunsystems, bieten sie den T-Helferzellen ihr Antigen-Material an. Dabei legen sie selbst fest, welchem Sparring-Partner sie ihr Antigen-Material präsentieren, T-Helferzellen vom Typ 1 oder Typ 2, und damit, ob verstärkt T- oder B-Lymphozyten aktiviert werden. Im Lymphknoten befinden sich verschiedene Zonen und auch eine Mischzone, in der beide Zellarten vorkommen. Die Langerhanszellen beteiligen sich damit nicht nur an der Abwehr, sondern sie entscheiden über das „Wie“ des Abwehrmechanismus. Nun beginnen die Immunsystemkaskaden, bei der weitere Immunbotenstoffe und Enzyme für das Fine-Tuning verantwortlich sind.
Spengler stellte fest, dass er mit seinen verschiedenen Mischungen gezielt unterschiedliche Immunantworten erzielen konnte. Um überschießende Reaktionen, wie sie vom Koch’schen Tuberkulin bekannt waren, zu vermeiden, verwendete er Verdünnungen (D9). Ferner hatte er viele Kinder als Patienten, die er schonen wollte. Er ahnte dabei nicht, dass das angeborene Immunsystem schon auf kleinste Moleküle reagiert. Prof. Bundschuh, Begründer des Labors für klinische und experimentellen Immunologie der Berliner Charité, zeigte später eindrucksvoll, dass diese kleinsten Wirkstoffmengen, so wie in den Spenglersanen vorhanden, einen nachweisbaren Effekt erzielen. Denn das angeborene Immunsystem erkennt sogenannte konservierte Strukturen. Also Anteile von Bakterien, die sich im Laufe der Evolution nicht veränderten, es sind Bestandteile, die das Bakterium selbst zum Überleben benötigt. Diese Form von Immunsystem weisen bereits Einzeiler auf. Viren und intrazellulär lebende Bakterien hingegen rufen Spezialisten auf den Plan; deren Erkennung, Bekämpfung und Elimination verantworten die B- und T-Zellen.
Ohne Erreger geht nichts
Immunantworten treten sehr komplex auf, sie entstanden in der Evolution als Antwort auf Erreger, abhängig von deren Art und vom Ort des Geschehens. Während der Darm Escherichia coli Bakterien als Symbionten akzeptiert, lösen sie in der Blase eine Entzündungsreaktion aus. Der Darm schützt sich mit einem Schleimfilm, sekretorischem lgA, Kommensalen wie den Milchsäurebakterien, pH-Wert-Regulation und jeder Menge lymphatischem Gewebe vor einer Überwucherung mit solchen durchaus pathogenen Symbionten im Darm.
Die immunologische Leistung beginnt also nicht erst im Inneren des Körpers, sondern an der Körperbarriere, durch Aufrechterhaltung des Säureschutzmantels, Schleimfilms und weiteren Maßnahmen, wie der Bildung von Immunglobulinen und Enzymen. Diese Schutzfunktionen entstehen nicht nur aus sich heraus, sondern steigern sich durch den Kontakt mit Erregern. Darmmikroben sind teilweise entscheidend an der Bildung von Schutzfilmen und auch am Energiestoffwechsel der Schleimhautzellen beteiligt.
Es macht also aus mehreren Gesichtspunkten Sinn, mit Erregern zu therapieren, anstatt gegen sie.
Spenglers Therapieansatz aus heutiger Sicht – das Spenglersan Kolloid K
Spengler betrachtete viele Erkrankungen als Folge von Infektionen. Er mahnte, dass Inkubationszeiten wesentlich länger sein könnten, als man sich zum damaligen Zeitpunkt vorstellte, und die Folgen nicht nur wesentlich später, sondern auch in ganz anderer „maskierter Form“ zum Tragen kämen.
Die Entwicklung von Heufieber und allergisch bedingtem Asthma bronchiale sah er als Infektion an, da er eine vermehrte Keimbesiedlung mit Streptococcus pneumoniae und Staphylococcus aureus feststellte. Er ging davon aus, dass dies ein konstitutionelles Problem sei und dass mit einer besseren Immunisierung gegen diese Erreger die Symptome nachlassen. Deshalb versah er sein Produkt mit dem Großbuchstaben K, wie Konstitution. Es wird bis heute für Patienten mit allergischen Erkrankungen eingesetzt.
Doch sehen wir uns einmal die beiden von Spengler benannten Erreger und ihre Eigenschaften an.

Streptococcus pneumoniae & Staphylococcus aureus – das Dream-Team
Streptococcus pneumoniae ist ein häufiger Haut- und Schleimhautbesiedler. Für gesunde Patienten hat er keinen Krankheitswert. Zeigt das Immunsystem allerdings die geringste Schwäche, entfaltet er sein pathogenes Potenzial und gilt als einer der häufigsten Auslöser für eine Lungenentzündung. Besonders betrifft dies Patienten mit bereits vorgeschädigter Lunge, allen voran mit COPD. Allerdings zeigte eine interessante Untersuchung, dass eine minimale Entzündung und Bildung von Abwehrkörperchen gegen Streptococcus pneumoniae gleichzeitig vor noch schlimmeren Infektionen schützt. Nun ist es zu früh, eine konkrete Aussage zu treffen, der Erreger scheint jedoch als Triggerfaktor lokaler Schutzfunktionen der Schleimhäute des Respirationstraktes eine wichtige Rolle zu spielen.
Der meist harmlose Hautbesiedler Staphylococcus aureus – abgesehen von multiresistenten Stämmen – erweist sich darüber hinaus als der häufigste Erreger eitriger Entzündungen und Wundinfektionen. Er spielt eine besondere Rolle im Immunsystem, denn er gehört zu den sogenannten Superantigenen. Das sind in der Regel die Toxine von Bakterien, die sich zunächst am Immunsystem vorbeischleichen und sich oft viel pathogener als das Bakterium selbst zeigen. Verschiedene Subtypen der Staphylokokken kennen wir wegen ihrer potenten Toxine. Sie können Erythrozyten schädigen, tief in das Gewebe eindringen und bindegewebsartige Strukturen auflösen. Sie verursachen schwere Verläufe wie das Lyell-Syndrom (Syndrom der verbrühten Haut) oder das durch Tampons verursachte Toxic-Schock-Syndrom.
Kein Wunder also, dass sich das Immunsystem mit Kräften gegen so ein trojanisches Pferd wehrt und neben erhöhter Zytokin-Bildung einen weiteren Giftabwehrmechanismus in Gang setzt.
Tatsächlich sehen neuere Publikationen einen Zusammenhang von Staphylococcus aureus mit der Entwicklung von atopischen Erkrankungen. Denn bei Patienten mit Neurodermitis, allergischem Asthma und Polypen ließ sich eine Bildung von IgE im Gewebe gegen Staphylococcus aureus und damit verbunden eine Eosinophilie nachweisen. Diese im Prinzip antiparasitäre Antwort scheint ferner die Bereitschaft zu allergischen Reaktionen zu steigern.
Lieber Keimschleuder als Allergiker?
Spenglers Beobachtung hat vor diesem Hintergrund also nichts an Relevanz verloren. Im Gegenteil – denn in unserer heute zu hygienisch gewordenen Welt fehlt es an immunologischen Auseinandersetzungen, allergische Erkrankungen nehmen zu.
Bekanntlich zeigen sich Kinder vom Bauernhof als weniger anfällig für Allergien als Stadtkinder, sie setzen sich schon in der frühen Kindheit mit einem wesentlich breiteren Spektrum von Erregern auseinander. Dabei kommt es keineswegs zu Infektionen, denn schon kleine Partikel von Erregern und Parasiten reichen aus, um das Immunsystem zu trainieren. Auch wenn die frühe Kindheit hinsichtlich der immunologischen Prägung die wichtigste Phase darstellt, bleibt dieser Mechanismus des Immuntrainings ein Leben lang erhalten. Wie eingangs bereits erwähnt, werden nicht nur fremde Antigene und Erreger, sondern auch Kommensalen und körpereigene Antigene dem Immunsystem präsentiert.
Insbesondere die milchsäurebildenden Kommensalen sind wichtig, um die Körperbarrieren zu schützen. Auch dieser Aspekt wurde von Spengler folgerichtig erkannt, deshalb setzte er in Davos ein weiteres traditionelles Therapieverfahren zur Barrierestärkung ein: die Einnahme und die Abwaschung der Haut mit Lacta-Essig. Dieser mildsaure Milchessig enthielt reichlich rechtsdrehende Milchsäure und ziemlich wahrscheinlich auch Milchsäure- und Essigbakterien. Rechtsdrehende Milchsäure und Apfelessig gehören zu den für den Darm und das gesunde Mikrobiom besonders wichtigen Präbiotika.
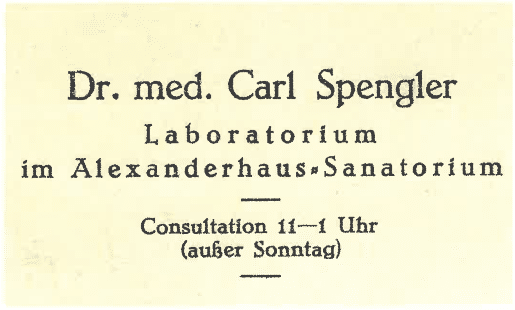
Die Spenglersan Therapie heute
In vielen naturheilkundlichen Praxen setzt man zur Therapie der Allergien, insbesondere des Heuschnupfens, das Spenglersan Kolloid K bis heute ein. Es ermöglicht eine akute Symptomlinderung und trägt langfristig zu einer besseren Immunantwort bei. Die Therapie erfolgt in der Regel über einen längeren Zeitraum, durchaus auch schon vor der Pollensaison. Zusätzlich kann ein reizlinderndes Präparat wie Neolin-Entoxin eingenommen und Euphrasia Augentropfen eingesetzt werden. Auch eine Kombination mit Antihistaminika ist zunächst denkbar. Zu einer ganzheitlichen Therapie gehören in der Regel weitere Maßnahmen, wie z.B. Schwarzkümmelöl-Kapseln, eine gesunde, basische Ernährung und eine Darmsanierung, z.B. mit dem Präbiotikum Lactasano und dem Probiotikum Intestisan, sowie eine Entgiftung und Ausleitung, z.B. mit der Kuckucks-Kur.
Auch die Folgen von dauerhaftem Stress darf man bei allen immunologischen Erkrankungen nicht vergessen. Denn Stresshormone wie Cortisol tragen oftmals zu einer Immunsystemschieflage bei. Deshalb spielen Entspannungsverfahren eine wichtige Rolle bei einer naturheilkundlichen Therapie. Oft zeigt sich der Erfolg erst in der Kombination verschiedener individueller Maßnahmen. Dabei sollte abschließend ein wichtiger Tipp von Spengler nicht unberücksichtigt bleiben: Er ließ seinen Patienten bei jedem Therapieschritt eine ausreichende Anpassungszeit.
Über die Autorin
Nicola Gruber
Heilpraktikerin und Pharmareferentin. Diverse Weiterbildungen Homöopathie, traditionelle Verfahren und Akupunktur, unter anderem an der Akademie für fachärztliche Akupunktur & integrative Medizin, Hannover Dozentin für medizinische Grundlagen und Naturheilverfahren im Ausbildungsbereich der Heilpraktiker seit 2005. Kontakt: nicola-gruber@mailbox.org